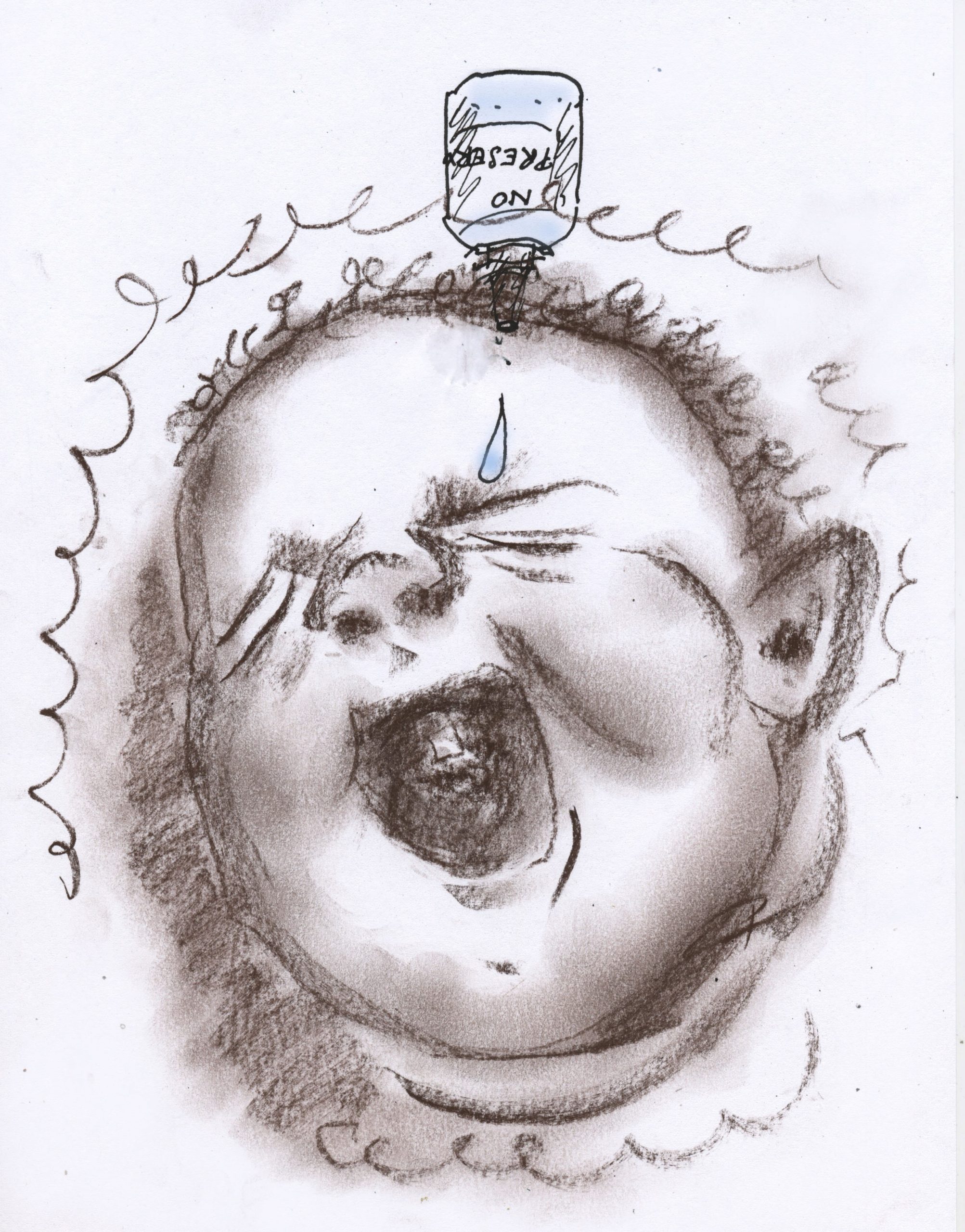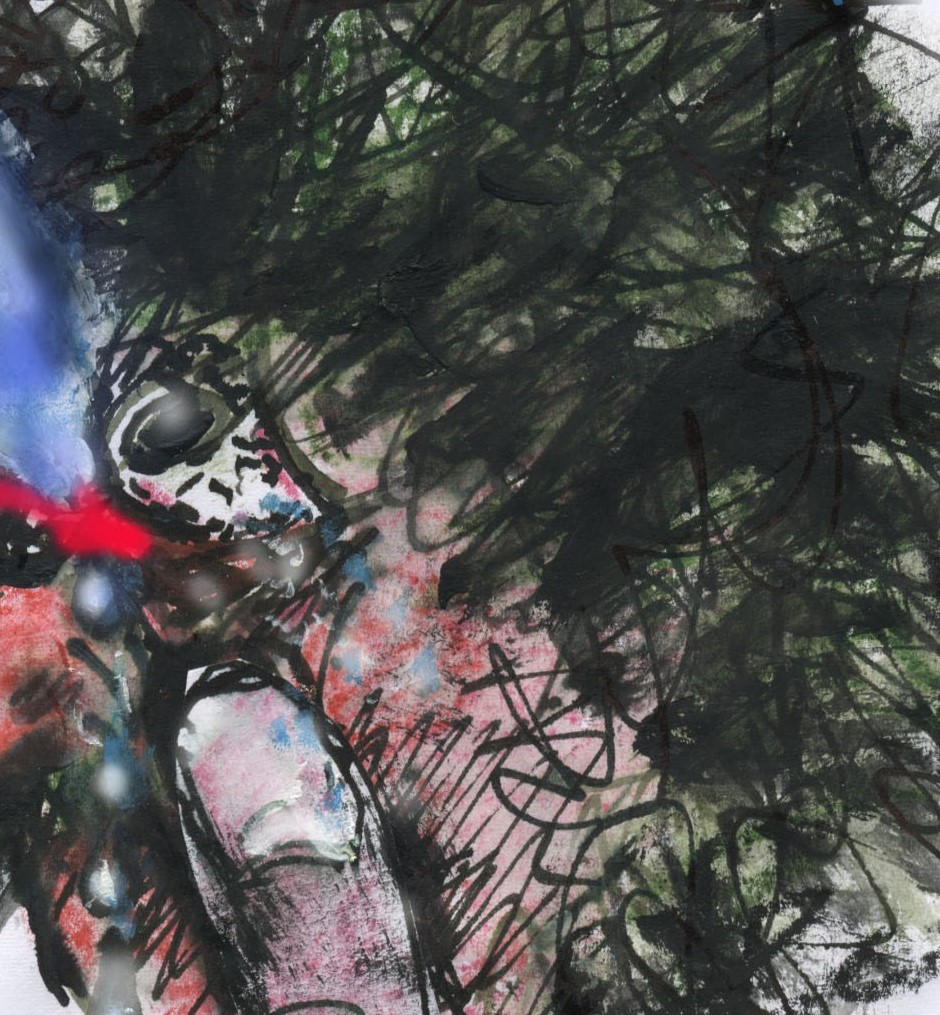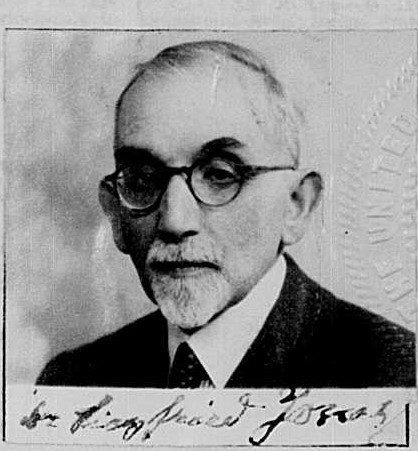Gesunde Augen
Peter Heilig
„Die Philosophie hat die Kinder vergessen“ (B. Schlink). Nicht nur die Philosophie. Mit dem Vergessen kämpft auch das Stiefkind ‚Gesundheits-Prophylaxe‘. Einige Stichworte zur Augen-Gesundheit:
Epigenetik:
Der Trend hin zu allgegenwärtig kurzwellig-dominiert-intensivem Kunstlicht, bis spät in die Nacht hinein, wirkt sich ‚epigenetisch prägend‘ aus. („Mammalian tissues retain a record of youthful epigenetic information, encoded by DNA methylation“).
Zunehmend werden die circadianen Rhythmen von Kindern und Jugendlichen schwer beeinträchtigt. Es resultieren chronisch Übermüdung, Dysphorien und depressive Verstimmungen – bis zur Suizidalität. „Daten aus dem klinischen Bereich belegen seit 2018 eine Steigerung bei suizidalen Gedanken und Handlungen bei unter 18-Jährigen um das Dreifache“ (Österreichische Ges. für Kinder- und Jugendpsychiatrie). Es wäre zu hoffen, dass diese Daten nicht stimmen.

Das Kunstlicht, zur falschen Zeit, mit falschen Intensitäten und falschen Spektren trägt Mitschuld – durch unphysiologische Stimulationen intrinsic photosensibler Melanopsin Retinaler Ganglienzellen (ipRGC).
Praenatal:
Medizinische Genetik-Beratung bei Verdacht auf genetische Erkrankungen – auch bei später Manifestation (Carrier-Screening).
Genetische Diagnostik:
Familienanamnese, Blutsverwandten-Diagnose, Chromosomen-Analyse, Einzel-Gen-Analyse, Array-CGH, Gen-Panel-Diagnostik, Exom-D. etc.
Neugeborenen-Screening:
Angeborene Augenfehlbildungen, teratologische Veränderungen, Nh-Dystrophien, kongenitale Katarakt, kongenitales Glaukom, seltene Retinoblastome, Astrozytome, Medulloepitheliome, Mb. Coats etc.
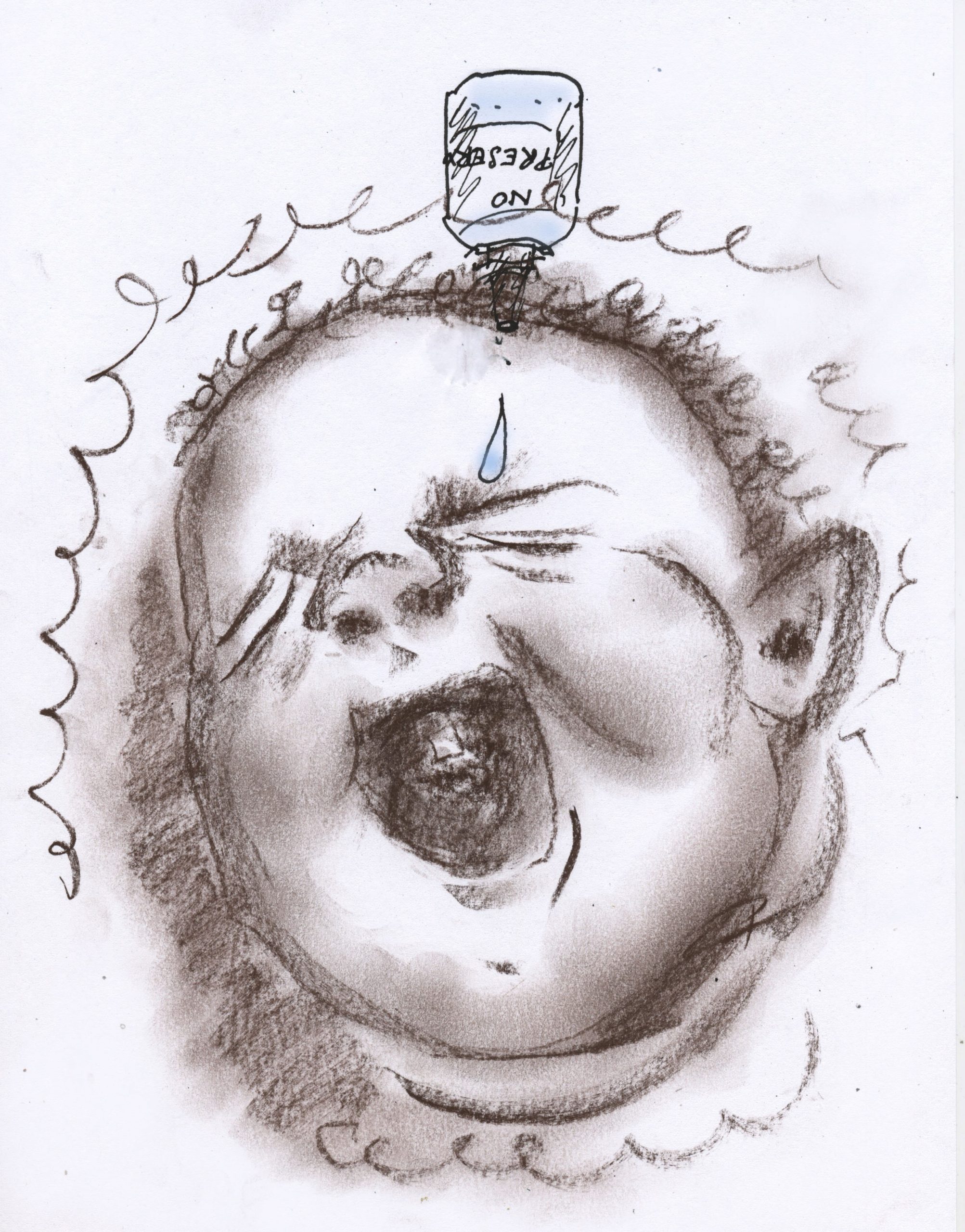
Retinopathy of Prematurity:
Durchorganisierte „lückenlose Screenings auf den Intensivstationen haben sich bewährt – um behandlungsbedürftige Kinder zeitgerecht Operationen zuzuführen“.
Neu: ‚Telemedicine in ROP‘

Paediatrische Ophthalmologie:
Entzündungszeichen etc. Schielen – ad Strabologie. Amblyopie-Prophylaxe;
Lähmungs-Schielen: Neuro-Ophthalmologie,.
Myopie- ‚Prophylaxe‘:
ausreichend Tageslicht/Bewegung; Fehlernährung vermeiden.
Siehe: EBM-Empfehlungen – https://www.augen.at/myopie/
Licht-Schäden vermeiden:
Sonnenbrille
optimal bräunlich getönt, entsprechend dunkel, ausreichend groß – ‚wrap around‘, angepasst an die jeweilige Tageslicht-Helligkeit. UV-Filter: Eine Conditio sine qua non. Cave extrem hohe Licht-Intensitäten, ganz besonders aus kurzen Distanzen.

Smartphone, Monitore, Tablet, PC etc.:
Dunkler Hintergrund mit heller Schrift, ‚Adaptive Brightness‘ etc. Blendungen und Reflexionen vermeiden, evtl. Gelbfilter.
Trauma-Prophylaxe: ‚unzerstörbare‘ Schutzbrillen, Sporthelm mit Kinnbügel –
zum Schutz von Gesicht-Schädel und Augen.
Infekte
bakteriell, viral, Chlamydien, (Akanth-)Amoeben, Pilze..
Hygiene: oberste Priorität für Kontaktlinsen- und speziell Ortho-K-Linsenträger
Lokale Therapie
vorzugsweise konservierungsmittelfreie Augentropfen etc.
Antibiotika-Therapie ausschließlich bei strenger EBM-Indikation.
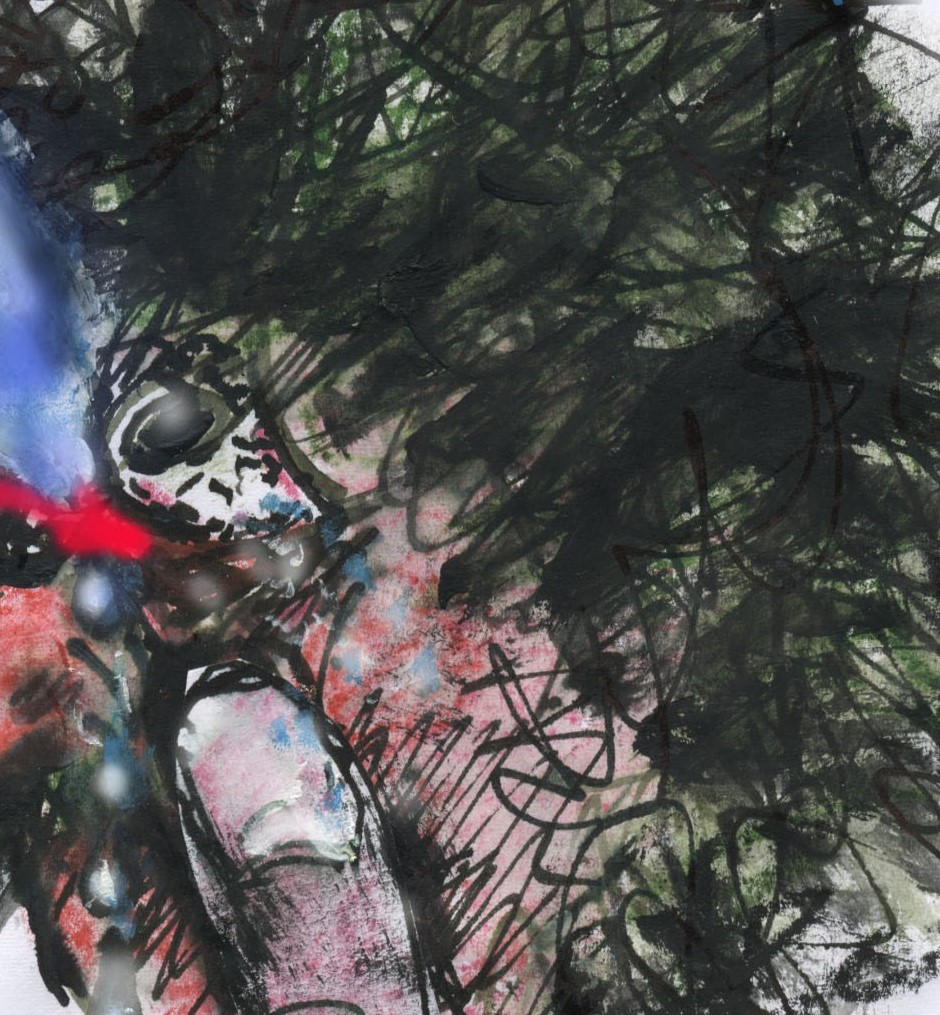
Fachärztliche Kontrollen
nicht nur bei Augen-Erkrankungen. Mutter-Kind-Pass!
Vermeidbar wäre –
Bewegungsmangel, Fehlernährung, Rauchen, Druck auf die Bulbi, Augenreiben – von sogenannten ‚Gesundheits‘-Gurus empfohlen.
Niemals Augen ‚Massage‘.
Vermeidbare Fehler beim Augen-Eintropfen:
Im Sitzen oder Stehen eintropfen – dabei kommt es nicht selten zum Berühren der Lidränder mit Pipetten oder Tropf-Fläschchen, dadurch mögliche Kontamination des Inhaltes; häufiges Abziehen des Unterlides kann das Lidgewebe schwächen. ,Beim Abtupfen der Lidränder werden Augentropfen z.T. wieder abgesaugt; Fasern, FK. etc. verbleiben an Lidern und evtl. Bindehaut.

Besser –
Augen liegender Patienten eintropfen: Dies gelingt selbst bei geschlossenen Pat.- Augen, auch bei Kindern – mit signifikant besserer Wirkung; ohne Abziehen des U-Lides; keine Gefahr der Kontamination. Überschüssige Tropfen unterhalb der Lider abtrocknen.
Zum Lösen von Synechien, werden u.A. Sympathicomimetica eingesetzt. Häufig wird diese Applikation ungeduldig – übertrieben oft wiederholt (cave RR-Anstieg), mit wechselndem Erfolg. Nach dem Eintropfen (vorzugsweise visköser) Präparate, bei liegenden bzw. weit zurückgelehnten Patienten stellen sich eher Erfolge ein.

Lit.:
Imamura K et al /2022) Mood phenotypes in rodent models with circadian disturbances. Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. ;13:100083
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/5-truths-about-protecting-your-eyes
Lu Y et al (2020) Reprogramming to recover youthful epigenetic information and restore vision. Nature;588(7836):124-129.
Lu CF et al (2023) The role of epigenetic methylation/demethylation in the regulation of retinal photoreceptors. Front Cell Dev Biol;11:1149132.
Hložánek M et al (2022) Trends in Neonatal Ophthalmic Screening Methods. Diagnostics (Basel);12(5):1251.
Dammann O et al (2023) Retinopathy of prematurity. Dev Med Child Neurol;65(5):625-631.
Beligere N et al (2015) Retinopathy of prematurity and neurodevelopmental disabilities in premature infants. Semin Fetal Neonatal Med.;20:346–53.
Heilig P (2023) Fehlernährung, Bewegungsmangel und Myopie. https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=40350350
Hilliam Y et al (2020) Pseudomonas aeruginosa and microbial keratitis. J Med Microbiol;69(1):3-13.
Su CY et al (2021) The Effect of Different Cleaning Methods on Protein Deposition and Optical Characteristics of Orthokeratology Lenses. Polymers (Basel).
13(24):4318
Goldstein MH et al (2022) Ocular benzalkonium chloride exposure: problems and solutions. Eye (Lond);36(2):361-368.
Naito T et al (2018) Comparison of success rates in eye drop instillation between sitting position and supine position. PLoS One;13(9):e0204363.
Mutter/Kind-Pass, Augen nicht vergessen: Hinweis aus gegebenem Anlass.
Epilog: Fragen sie (Fach-) Arzt und.. (sonst niemanden)
Brückner: https://www.aerzteblatt.de/archiv/54889/Frueherkennung-von-Sehstoerungen-bei-Kindern

Gender: ‚beyond‘
Interest: no
*************************
Veranstaltungshinweis
Peter Wurnig & Peter Heilig
Magische Momente, auf der Bühne und . .
Neuromagie
24.1. 2024 19h
Information: EINLADUNG.PDF
*************************
Weitere Beiträge »