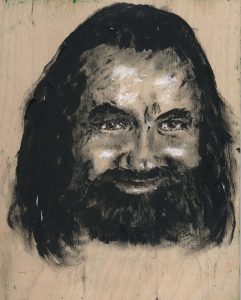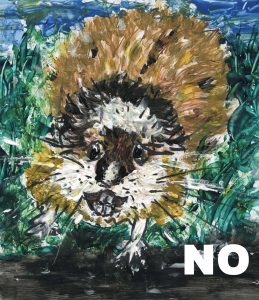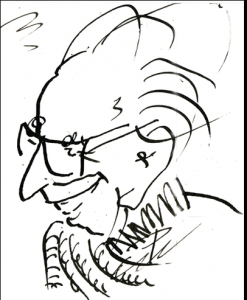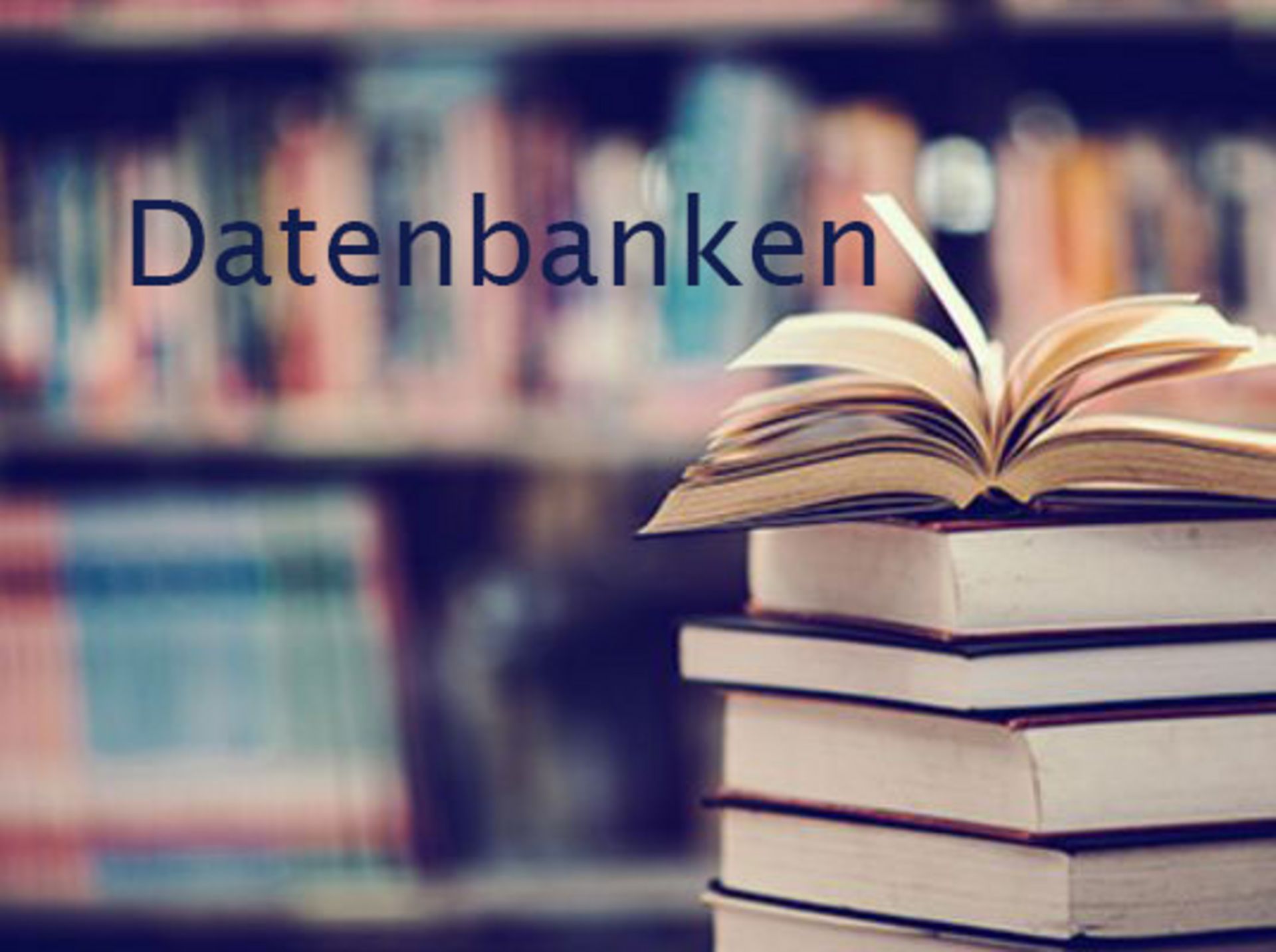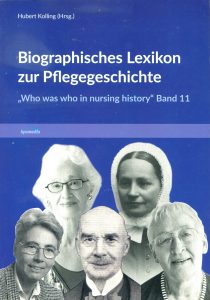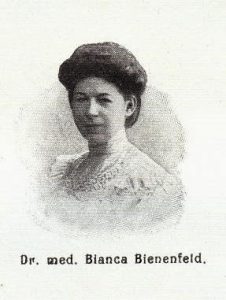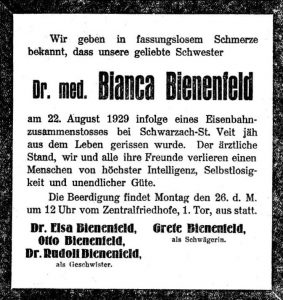KIPP- _
– PUNKTE …..
„Kippdynamiken wären auch bei Stabilisierung oder Verringerung der globalen Temperatur nicht direkt umkehrbar.“ (Nat Commun. 2024 Jan 6;15(1):343). Die Metapher Kipp-Punkte macht Angst mit Zerrbildern plötzlich hereinbrechender globaler (?) Katastrophen, ohne Vorwarnung – scheinbar schicksalhaft, unabwendbar.
Diese Dynamiken verlaufen nicht wie ‚Sprungfunktionen‘ oder Niagara Daredevil-Abstürze über Wasserfall-Abrisskanten oder die sagenhaften Lemming-Klippensprünge, an die nicht einmal mehr die Film-Industrie glaubt. Auf ‚Evolutions-Uhren‘ sehen die erwähnten ‚Kipp‘-Änderungen wie Zeitraffer-Dokumentationen aus; doch diese Uhren messen heutzutage digital – das Analoge kam aus der Mode. Viele allmählich zunehmende Änderungen wie Starkregen-Entwicklungen – zum Beispiel – wurzeln im Vergangenen.
Tipping Element Interaktionen fordern aufgrund hoher Komplexität sowie Variabilität die Forschung heraus; Historizität ist gekennzeichnet von der „Einmaligkeit sowie von Sub-Merkmalen: Irreversibilität, Phasenübergängen und Emergenzen“ (1,2,3). Skrutiniertes und penibles Dokumentieren von Daten, beispielsweise meteorologischer – seit Beginn der Aufzeichnungen (M.M. Heilig) – ermöglicht wesentlich solideres Extrapolieren und darauf aufbauend verlässlicheres Prognostizieren. Hochwasser-Analysen und – Warnungen erfahren besonders durch das Zusammenführen weltweiter Daten (Satelliten-Daten etc.) Optimierungen. Die Zukunft läge in einer wirkungsvollen Schadensbegrenzung – z.B. im Hochwasser-Krisen-Management und noch mehr in konsequenter Prophylaxe.
HOCHWASSER- NOTRUFE ÖSTERREICH:
WIEN: 122
Landeswarnzentrale
NIEDERÖSTERREICH: 122
oder
Hotline „Hilfe bei Hochwasser“:
02742/9005-13352
oder
Hochwassertelefon:
+43/2742/9005-13178
+43/2742/9005-16480
07:30 bis 08:00 Uhr täglich;
nur durchgängig erreichbar bei Donauhochwasser.
https://www.noel.gv.at/wasserstand/#/de/Messstelle
OBERÖSTERREICH: 130
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/hochwasser.htm
BURGENLAND: 130
Landessicherheitszentrale (www.lsz-b.at)
SALZBURG: 122
+43/662 8042 4314
KÄRNTEN: 130
https://hydrographie.ktn.gv.at/
STEIERMARK: 130
+43/676 8666 1963
TIROL: 130
+43/512 508 4202
VORARLBERG: 130
+43 5574 511 27405
DESIDERATUM: ‚Bundesharmonisierung‘:
Bundesweit nur eine einzige Nummer,
z.B.: 130 > automatische Ortung>Weiterleitung>Expertise
aktualisiert, punktgenau: „es wird bearbeitet…“
Abgesehen von Feuerwehr (122) und Euro-Notruf (112) gibt es einen Notruf für Gehörlose und Hör-Beeinträchtigte: DEC112. Das ist eine barrierefreie Notruf-App für textbasierten Notruf an Polizei (112 und 133), Feuerwehr (122) und Rettung (144). Oder auch 0800 133 133 für den Notrufnummer mittels SMS.
Kein Wort hier über weitere Arten von Klima-Katastrophen – vor Allem kein ‚Asocial-Media-Menetekel‘ – auf unsichtbarer Wand, wie etwa auf Marlen Haushofers undurchdringlicher Barriere, welche Verständigung und Versöhnung blockieren. Denn noch nie gab es einen ‚Wissens‘-Krieg mit Gefährdung von Gesundheit und Leben. Wirtschaftkriege, Religions‘-Kriege, jeweils im Namen eines Allerhöchsten und die üblichen Scharmützel weltweit, in denen es um Bodenschätze oder noch Wertvolleres geht – auf den Übungstummelplätzen der Kriegsindustrie und ihrer Marionetten. Ein ‚WISSENS‘-Krieg fände möglicherweise am Grünen Tisch statt. Er wäre im Denk-Ansatz beendet – für ewige Zeiten, ohne entbehrliche Unterstützung von überbewerteter AI/KI.
Auf der Suche nach Schuldigen muss Digitale Demenz ausgeklammert weren – AI/KI sind zu exkulpieren. Sie sind kein ‚ens a se‘ sondern bloß ‚res‘; nicht satisfaktionsfähig. Ohne ein Selbst, ohne Gewissen. ‚Autonome‘ Aktionen, welche allzu oft fatal endeten, gehen nicht auf ihr Konto, da diese Dinge, Gewissen-los und Hirn-los, nicht entscheidungsfähig sind. Deren unschätzbaren technischen Vorteile sollen jedoch nicht geschmälert werden. Redlich erworbenes dementes homo sapiens-Verhalten wäre – viribus unitis – reparabel.
Eine ‚Als Ob‘ Philosophie könnte vielleicht helfen – als Psycho-Hygiene. Die Realität als Albtraum in die Schranken weisen und auf euphorisches Erwachen freuen. Galgenhumor und mehr als das. Ändern, was zu ändern ist. Gipfel- und Höhen-Erlebnisse, auch längst vergangene, genießen, das Kind im Ich am Leben erhalten – und unbedingt: sein Lachen.
(Viktor Frankl, trotzdem lachend: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=26794)
Epilog: Versäumt wurden viel zu oft: Renaturierungen, Auffang-Becken, – Gerinne, – Flächen und begrünte Dächer (siehe ‚Schwammstadt‘), Aufbrechen von Versiegelungen – dieser glühenden Asphalt- und Betonwüsten mit ‚Kachelofen‘- Wärmespeicher-Effekt, die Rettung der Moore etc. Es ist nie zu spät. ()
1. Riedl R (2000) Strukturen der Komplexität. Eine Morphologie des Erklärens und Erkennens. Springer
2. Lenton TM et al (2024) Remotely sensing potential climate change tipping points across scales.
3. Kubiszewski I et al (2025) Cascading tipping points of Antarctica and the Southern Ocean. Ambio;54(4):642-659. „several of the major Antarctic interconnected tipping points (tp), including the physical, biological, chemical, and social t.p .“
Tipping Elements: Instabilität antarktischer, Grönländischer Eis-Schilde, Permafrost, – der El Niño–Southern Oscillation (ENSO), aktischer/antarktische Oszillationen (Polarwirbel, polar vortex) chaotische Multistabilität indischer und Westafrika – Monsune, atlantischer und arktischer Tiefenwässer. Gletscherschwund, Absterben borealer Wälder etc.
 Tipping Points, Kipp-Punkte: abrupte, Änderungen, „nicht umkehrbar“. ‚Elusive‘ Eintritts-wahrscheinlichkeit nichtlinearer Systeme – keine mathematische geschlossene Methode anwendbar. Die (Klima-) Auswirkungen Geopolitischer Konflikte sind nicht vorhersagbar.
Tipping Points, Kipp-Punkte: abrupte, Änderungen, „nicht umkehrbar“. ‚Elusive‘ Eintritts-wahrscheinlichkeit nichtlinearer Systeme – keine mathematische geschlossene Methode anwendbar. Die (Klima-) Auswirkungen Geopolitischer Konflikte sind nicht vorhersagbar.
Emergenz: Auftreten neuer Eigenschaften oder Strukturen in einem System, welche nicht einfach aus der Summe seiner Einzelteile vorhergesagt oder erklärt werden können. Diese neuen Eigenschaften entstehen durch die Interaktion und das Zusammenspiel einzelner Elemente. https://www.wortbedeutung.info/Emergenzen/
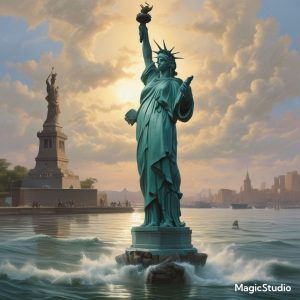 Menetekel: böses Omen, Unheil-verkündende Prophezeiung: מְנֵ֥א מְנֵ֖א תְּקֵ֥ל וּפַרְסִֽין
Menetekel: böses Omen, Unheil-verkündende Prophezeiung: מְנֵ֥א מְנֵ֖א תְּקֵ֥ל וּפַרְסִֽין
________________________
Einladung
ALLOTRIA
p heilig UND*
ZEIT: am Dienstag, 10. Oktober 2025 um 19 Uhr
ORT: Otto-Mauer-Zentrum
Einladung: PDF
Nähere Infos: Einladung.pdf
_________________________
Interessenkonflikt:
Der Autor erklärt, dass bei der Erstellung
des Beitrags kein Interessen –
konflikt im Sinne der Empfehlung des
International Committee of Medical
Journal Editors bestand.
Gastautor:
Korrespondenzadresse:
Univ.-Prof. Dr. med. Peter Heilig
Augenheilkunde und Optometrie
peter.heilig@univie.ac.at
_________________________