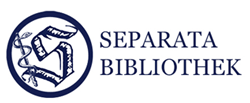[210]: Else Volk-Friedland – Frauenärztin, Autorin, Herausgeberin, NS-Verfolgte
Text: Dr. Walter Mentzel
Else (Elsa) Friedland wurde am 21. März 1880 als Tochter von dem aus Miskolc in Ungarn stammenden Eduard Friedland (1850-1929) und der aus Hlinka in Mähren (heute: Tschechien) stammenden Charlotte Steiner (1855-1942) in Wien geboren. Seit Juni 1908 war Else mit dem Dermatologen Richard Volk (1876-1943) verheiratet, mit dem sie gemeinsam die Kinder Georg Heinrich (1910-1959) und Eva Franziska (1912-1983) hatte.
Friedland absolvierte zunächst die gymnasiale Mädchenschule des Vereines für erweiterte Frauenbildung, maturierte 1899 am Akademischen Gymnasium in Wien, und begann danach an der Universität Wien mit dem Studium der Medizin, das sie am 3. März 1905 mit der Promotion abschloss.
Schon während ihres Studiums arbeitete Else Friedland vom 1. Jänner 1904 bis 1. Jänner 1907 als Demonstratorin am Neurologischen Institut bei Prof. Heinrich Obersteiner (1847-1922), der sie selbst dazu ernannt hatte. Friedland, die die erste Universitätsangestellte und erste weibliche Demonstratorin war, beschäftigte in dieser Hinsicht die Universität sowie das Ministerium für Cultus und Unterricht in der prinzipiellen Frage der Anstellung von Akademikerinnen an universitären Einrichtungen.[1]
Nach einer insgesamt dreijährigen Tätigkeit als Aspirantin an verschiedenen Abteilungen und Kliniken, darunter 1906 bei Prof. Julius Wagner-Jauregg (1883-1940),[2] arbeitete sie als Sekundarärztin am Allgemeinen Krankenhaus Wien. Daneben führte Else Friedland seit Februar 1907 eine private Ordination für Nerven- und Frauenkrankheiten in Wien 8, Lange Gasse 63.
In der frühen Phase ihrer Karriere als Ärztin schien sie weiterhin Interesse an der Psychiatrie und Neurologie gefunden zu haben. Im Oktober 1908 nahm sie an dem in Wien stattfindenden 3. Internationalen Kongress für Irrenpflege teil, 1910 schrieb Else Volk-Friedland in den Mitteilungen des 1903 gegründeten Frauenvereins „Diskutierklub“ „Ueber psychische Interaktion und Massenpsychosen“,[3] weiters war sie das einzige weibliche Mitglied der „Wiener Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie“. 1907 hielt sie vor dem „Neuen Frauenklub“ einen Vortrag über populäre und wissenschaftliche Anschauungen nervöser Erkrankungen“,[4] und im selben Jahr einen weiteren im Rahmen der Ausstellung „Das Kind“ über die Gefahren sexueller Erkrankungen bei Jugendlichen“.[5]
Jahresbericht des Vereins für erweiterte Frauenbildung 1907/1908, Wien 1908.
Ab dem Schuljahr 1905/1906 unterrichtete sie das Fach Hygiene an der Schwarzwald-Schule in Wien.[6] 1912 erfolgte ihre Ernennung durch den Verein zur Förderung der höheren kommerziellen Frauenbildung zur Schulärztin, und im selben Jahr wirkte sie als Mitglied in der im Jänner 1912 gegründeten Sektion 6 der Zentralstelle für körperliche Erziehung der Schuljugend in Niederösterreich mit,[7] die sich mit der Ausbildung der weiblichen Jugend befasste.[8]
Während des Ersten Weltkrieges – ihr Ehemann Richard war seit 1915 in russischer Kriegsgefangenschaft – gründete sie eine Hilfsgruppe für die in russischer Kriegsgefangenschaft weilenden österreichischen Kriegsgefangenen in Samarkand-Chodschent, durch die Geldmittel gesammelt werden sollten, um das Leid in der Gefangenschaft zu lindern. Hier übernahm Volk-Friedland den Vorsitz in der Organisation.[9]
Kinder-Ambulatoriums im Wiener „Charitas-Haus“
Ab 1919 leitete sie das Kinder-Ambulatoriums im „Charitas-Haus“ der Gemeinde Wien in Wien Neubau, wo seit Oktober 1918 auch eine Lichttherapie für Kinder („Lederer-Belichtungsambulatorium“)[10] angeboten wurde.
Referentin, Autorin und Mitherausgeberin der Zeitschrift „Die Frau und Mutter. Illustriertes Familienblatt für Kinderpflege, Erziehung sowie Gesundheit in Haus und Familie“
Else Volk-Friedland hielt auch nach dem Ersten Weltkrieg bis in die 1930er Jahre hinein regelmäßig Vorträge, wie u.a. 1921 vor dem Verein Bereitschaft zur „Hygiene des Alltages“,[11] der Sexualkunde und Fragen der Hygiene. 1928 nahm sie als Referentin neben Dora Brücke-Teleky (1879-1963), Pauline Feldmann (1884-1986), Marie Proksch (1892-?), Frieda Becher-Rüdenhof (1874-1951) und Wilhelmine Löwenstein-Brill (1884-1971) an der Delegiertenversammlung der Internationalen Ärztinnenvereinigung in Bologna teil.[12]
Vor allem aber entfaltete Else Volk-Friedland über viele Jahre eine reiche Publikationstätigkeit in der Zeitschrift „Die Frau und Mutter“ aber auch als Autorin in der Zeitung „Die Frau“[13], im Wiener Tagblatt, oder 1932 „Die Schönheit des Alters“ in der Zeitschrift „Das Wort der Frau“.
Else Volk-Friedland schrieb seit 1912 regelmäßig in der Zeitschrift „Die Frau und Mutter. Illustriertes Familienblatt für Kinderpflege, Erziehung sowie Gesundheit in Haus und Familie“, das ein traditionelles und konservatives Frauen- und Familienbild transportierte. In ihren Artikeln versuchte sie in einer niederschwelligen pädagogischen Form medizinische Themen zur Frauen- und Kinderhygiene, zur Mutterschaft und zu Erziehungsfragen, aber auch durch Artikel, die sich mit der Bewältigung verschiedenster Alltags- Lebenssituationen beschäftigten, einem breiteren Publikum näher zu bringen. Dazu zählen beispielsweise ihre Artikel aus dem Jahr 1913 „Kinderpflege in der kalten Jahreszeit“, 1914 „Einiges zur sexuellen Aufklärung“, 1915 „Der Kriegssommer in der Stadt“ und „Der Proletarierhaushalt in der Kriegszeit“, 1925 „Ueber die Schutzpockenimpfung“, 1927 „Einiges über Krankenkost“, 1928 „Wann ruft man den Arzt“ und 1929 „Rechtzeitiges Erkennen der Kinderkrankheiten“, „Das nervöse Schulkind“, „Wenn die stillende Mutter krank wird“. In dieser Zeitschrift, die ab 1916 auch das offizielle Organ des Bundes für Jugenderziehung war, war sie zunächst ab 1914 (Heft 9) mit der Mutter von Franz Kafka, Julie Loewy (1856-1934), und Heinrich Ernst Schwartz und danach gemeinsam mit Lia Lazansky die Mitherausgeberin.
1907 erschien von ihr nach einem Vortrag vor der provisorischen Frauen-Wohlfahrts-Zentrale die Broschüre „Wie schütze ich mein Kind und Mich vor Übertragung gefährlicher Krankheitskeime (Bazillen, Mikroben). 1928 publizierte sie „Wenn du dich als Mutter fühlst. Ärztliche Aufklärungen für werdende Mütter“ in der Reihe „Schwarz Merkbücher“ und im selben Jahr in derselben Reihe die Broschüre „Die Frau von fünfzig Jahren und ihre richtige Lebensführung“. 1930 erschien von ihr unter der Herausgeberschaft der Frauen- und Mütter-Vereinigung „Richtige Säuglings- und Kinderernährung. Ein zeitgemäßer Führer für junge Mütter u. Pflegerinnen“. 1931 publizierte sie den Aufsatz „Die schulärztliche Sprechstunde“ in der Zeitschrift „Volksgesundheit. Organ der Österreichischen Gesellschaft für Volksgesundheit“. 1937 erschien von ihr bereits in der 4. Auflage die gemeinsam mit der Journalistin Julie Lachner erarbeitete Monografie „Meinem Kinde. Mit Mutters Tagebuch und illustrierten Merkblatt“.
Bund für Jugenderziehung
1919 beteiligte sich Else Volk-Friedland als Mitglied des im November 1916 gegründeten Bundes für Jugenderziehung[14] an einen Aufruf zur Schaffung einer Elternvereinigung in Wien und der Gründung von Schul- Bezirks- und Stadt-Elternausschüssen.[15]
Flucht und Exil Mexiko
Else und ihr Ehemann Richard Volk waren wegen ihrer jüdischen Herkunft nach dem „Anschluss“ im März 1938 der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Ihnen und ihren beiden Kindern Eva und Georg gelang 1939 die Flucht nach Mexiko, wo Else nach dem Tod von Richard Volk im Jahr 1943 dessen bis dahin gemeinsam geführte Arztpraxis weiter fortführte. Else Volk-Friedland leistete in Mexiko einen wesentlichen Beitrag für die deutschsprachige Exilliteratur in Lateinamerika. Sie war gemeinsam mit der ebenfalls aus Wien nach Mexiko vertriebenen Medizinerin und Sexualreformerin Marie Frischauf-Pappenheim (1882-1966), sowie mit dem Journalisten Bruno Frei (1897-1988) und den Schriftstellern Leo Katz (1892-1954) und Egon Erwin Kisch (1885-1948), Mitbegründerin des 1942 gegründeten Exilverlages „El Libro Libre“, der von dem Dramaturgen und Verleger Walter Janka (1914-1994) geleitet wurde. Sie selbst war noch als Schriftstellerin, Übersetzerin und Malerin tätig und gestaltete in Mexiko Radiosendungen zur österreichischen Literatur und zum österreichischen Theater wie u.a. im Oktober 1943 „Das Wiener Burgtheater“, im April 1944 „Die österreichischen Literatur“, im Juli 1945 „Warum lieben wir Mexico“ oder im September 1945 „Theaterkultur in Österreich“. 1942 erschien von ihr als Übersetzung die von Paul Gutmann verfasste Novelle El retorno del hombre de las cavernas (Die Rückkehr des Höhlenmenschen“).
Plataforma Digital CDIJUM: Ficha Migratoria: Else Friedland de Volk.
Daneben arbeitete Volk-Friedland noch an den Exilperiodika „Freies Deutschland“ und „Demokratische Post“ mit, verfasste hier Artikel, und fungierte als Vizepräsidentin in der „Accion Republicana Austriaca“ (ARAM), wo u.a. auch die beiden Ärzte Hans Pilz und der Kinderarzt an der Poliklinik in Wien Kurt Wallis, sowie die Schriftsteller Bruno Frei und Leo Katz mitwirkten. Hier arbeitete sie auch an der Herausgabe der zweisprachigen Exilzeitung „Austria Libre“ mit.[16] 1946 publizierte Volk-Friedland im mexikanischen Verlag Prometeo ihren Roman „Cristo y el Judia“, in dem sie sich mit den christlichen Wurzeln des Antisemitismus auseinandersetzte.
Sie verstarb am 27. Februar 1953. Ihre Tochter Eva Volk Friedland verstarb 1983 in Benito Juarez, Mexiko, ihr Sohn Georg (Jorge) 1959 in Cuauhtemoc, Mexiko.
Quellen:
Matriken der IKG Wien, Geburtsbuch 1880, Else Friedland.
UAW, Med. Fakultät, Nationalien/Studienkataloge, Sign. 134-0587, Friedland Else (Nationalien Datum: 1902/1903).
UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 195-079a, Friedland Elsa (Rigorosum Datum: 17.2.1905).
UAW, Rektorat, Med. Fakultät, Rigorosen- und Promotionsprotokolle, Sign. 190-0153, Friedland Elsa (Promotion Datum: 3.3.1905).
ÖStA, AdR, E-uReang, VVSt, VA, Zl. 35.148, Volk-Friedland Else.
III. Internationaler Kongress für Irrenpflege, Wien Oktober 1908. Offizieller Bericht (Hg. vom Generalsekretär Prof. Dr. Pilcz), Wien 1909.
Plataforma Digital CDIJUM: Ficha Migratoria: Else Friedland de Volk.
México, Distrito Federal, Registro Civil, 1832-2005, Elsa Friedland Steines, 1953.
Kloyber Christian/Patka Marcus G. (Mit einem Geleitwort von Friedrich Katz), Österreicher im Exil: Mexiko 1938-1947. Eine Dokumentation, (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Wien 2002.
Keywords:
Else Volk-Friedland, Frauenheilkunde, Schriftstellerin, NS-Verfolgte, Mexiko, Ärztin, BBL Bio-bibliografisches Lexikon, Bio-bibliographisches Lexikon, Biobibiografisches Lexikon, Medizingeschichte, NS-Verfolgte, Wien
[1] Jahresbericht des Vereines für erweiterte Frauenbildung in Wien, 1907/1908, Wien 1908, S. 4; Blatt der Hausfrau, H. 25, 1904-1905, S. 658.
[2] Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine, H. 6, 1906, S. 7.
[3] Mitteilungen des Frauenvereines Diskutierklub, Nr. 1, 1910, S. 4.
[4] Die Zeit, 22.3.1907, S. 6.
[5] Die Zeit, 20.6.1907, S. 6.
[6] 5. Jahresbericht des Mädchen-Lyzeums der Frau Dr. phil. Eugenie Schwarzwald in Wien. Am Kohlmarkt, Wien 1907, S. 73.
[7] Wiener Zeitung, 31.1.1912, S, 4.
[8] Moderne illustrierte Zeitung für Reise und Sport, H. 5, 1912, S. 31.
[9] Die Zeit, 29.12.1916, S. 5.
[10] Die Frau, 22.3.1919, S. 4.
[11] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), 2.5.1921, S. 6.
[12] Neue Freie Presse, 8.4.1928, S. 13.
[13] Die Frau, 25.12.1919, S. 4.
[14] Zeitschrift für Frauen-Stimmrecht. Organ für die politischen Interessen der Frau, H. 9, 1916, S. 6.
[15] Die Frau und Mutter, H. 8, 1919, s. 54.
[16] Freiheit für Österreich (Austro American Tribune), H. 10, 1944, S. 4
Normdaten (Person) Volk-Friedland, Else: BBL: 40654; GND: in Bearbeitung
Bitte zitieren als VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien, BBL: 40654 (06.03.2023); Letzte Aktualisierung: 2023 0308
Online unter der URL: https://ub.meduniwien.ac.at/blog/?p=40654