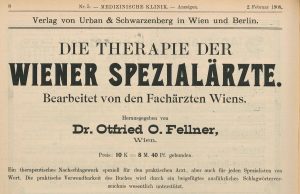Stern, Marianne – Erste beeidete Sachverständige für Lebens- und Genussmittel, Kücheninspektorin, Buchautorin, Antiquarin und NS-Verfolgte
Text: Walter Mentzel
Marianne Stern war über 30 Jahre lang bis 1938 eine weit über Wien hinaus bekannte Persönlichkeit, die mit ihren Vorträgen und Publikationen die traditionelle Wiener Küche mit den Erkenntnissen der zu dieser Zeit noch jungen Ernährungswissenschaft und Nahrungsmittelkunde sowie den zeitgenössischen Modernisierungs- und Technisierungsprozessen bei der Nahrungszubereitung und der Küchenorganisation zu verbinden verstand. Sie war in Österreich die erste Frau, die als beeidete Sachverständige für Lebens- und Genussmittel tätig wurde. Ihr gelang es breite Bevölkerungsschichten mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel wie Lichtbildvorträgen und später im Rundfunk für eine gesundheitsbewusste Ernährung zu sensibilisieren, rationellere mit hohen hygienischen Standards versehene Koch- und Verwertungsmethoden zu fördern und moderne ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse geläufig zu machen. Sie trug unter anderem zur Verbreitung der vegetarischen Küche bei, problematisierte die Krankenernährung und organisierte und propagierte neue Formen der Großküche u.a. im Spitalswesen. In den 1920er und 1930er Jahren fanden ihre Arbeiten auch innerhalb der medizinischen Wissenschaften ihre Würdigung, wie u.a. 1931 in dem von Prof. Heinrich Schur (1871-1953) in der Wiener medizinischen Wochenschrift verfassten Aufsatz „Allgemeine Ernährungslehre mit besonderer Berücksichtigung der modernen Diätkuren“.[1] Sie selbst publizierte schon vor dem Ersten Weltkrieg einen Artikel in der von Isaak Segel herausgegebenen Zeitschrift „Medizin für alle“.

Marianne Stern (Stehend, erste von Links). Die Bühne. H. 78. 1926. S. 12.
In ihren Vorträgen, Zeitschriftenartikeln und Büchern spiegeln sich thematisch jene im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts auftretenden Krisenerscheinungen wider, wie die lange anhaltende Phasen der Inflation, Wirtschaftseinbrüche, Massenarbeitslosigkeit, Hungersnöte und die durch den Ersten Weltkrieg hervorgerufene sozialen Verwerfungen. Stern versuchte mit ihrer Arbeit der Mangelwirtschaft und der finanziellen Not mit pragmatischen Lösungsvorschlägen zu begegnen. Ebenso reflektierte sie ab Mitte der 1920er in der Phase der Stabilisierung der Wirtschaft die gesellschaftlichen Veränderungen im Konsumverhalten und die Trends nach gesunden Ernährungsweisen und dem steigenden Bedürfnis einer Kultivierung des Nahrungsverzehrs, während sie gleichzeitig die ansteigende Zeitverknappung der Haushaltsarbeit durch die zunehmende Integration von Frauen in die Lohnerwerbsarbeit berücksichtige.
Marianne Stern wurde am 22. Juni 1882 als Tochter des Buchhändlers und Antiquars Moritz Stern (1846-1913) und Charlotte Toch geboren. Seit spätestens 1902 war sie Mitglied des Wiener Hausfrauen-Vereins und im Alter von 24 Jahren absolvierte sie im März 1906 als Erste die Prüfung als Kochschullehrerin an der „Ersten Wiener Privatkochschule“ von Eugenie Edler von Petravic.[2]
Erste weibliche beeidete Sachverständige für Lebens- und Genussmittel
Im März 1908 erfolgte ihre Ernennung zur ersten weiblichen beeideten Sachverständigen für Lebens- und Genussmittel beim k.k. Landesgericht für Strafsachen in Wien[3] und, nachdem sie im selben Jahr auch erfolgreich eine Kochschulausstellung kuratiert hatte,[4] eröffnete sie 1909 die „Koch- und Haushaltsschule Marianne Stern“ in Wien 6, Getreidemarkt 17[5] mit den Schwerpunkten Nahrungsmittellehre, Kranken- und Kinderernährung. 1908 erschien von ihr im Verlag ihres Vaters, ihr erstes Kochbuch unter dem Titel „Kochbuch der Küchenreste“, das auf Kochkunstausstellungen in Wien und in Temesvár (heute Timisoara/Rumänien) prämiiert wurde.[6]
Referentin und Autorin von Kochbüchern bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Stern war eine gesuchte Vortragende. Sie referierte u.a. vor wissenschaftlichen Vereinigungen, Volksbildungsstätten, Frauenorganisationen, erstmals wahrscheinlich im April 1908 im Wiener „Frauenverein Diskutierklub“ zum Thema „Über rationelle Ernährung“,[7] dem weitere Vorträge in der „österreichischen Konsumentenliga“ folgten.[8] 1910 informierte sie im Wissenschaftlichen Klub[9] über die „Ernährungsweise des Menschen“ und im selben Jahr gab sie auf Veranlassung der Reichsorganisation der Hausfrauen in Triest ein Gutachten zum argentinischen Importfleisch ab,[10] worüber sie im September 1910 im Festsaal des niederösterreichischen Gewerbevereines ihre Untersuchungsergebnisse präsentierte.[11] 1908 und 1912 nahm sie an der Internationalen Kochkunstausstellung in Wien teil.[12] Auch publizistisch war sie schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg tätig, darunter regelmäßig in der Zeitschrift „Wiener Mode“, wo sie über eine eigene Rubrik verfügte. Die vor dem Ersten Weltkrieg kumulierende Teuerungskrise, die in den Teuerungsrevolten in Wien im September 1911 ihren Höhepunkt erreichten, beschäftigte Stern schon seit 1910, als Mitglied des Aktionskomitees „Frauen gegen die Teuerung“ der Reichsorganisation der Hausfrauen.[13]
Stern und die Kriegsküche während des Ersten Weltkrieges
Auch während des Ersten Weltkrieges standen für Stern die Folgen der Teuerung und die zunehmende Nahrungsmittelnot im Zentrum ihrer Vortrags- und Publikationstätigkeit. Schon im Oktober 1914 wirkte sie an der von der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs (ROHÖ) organisierten „Gruppenküche“ der ROHÖ für die Kriegszeit zur Hilfe in Krisenzeit mit, die sich an die rasant verarmenden Bevölkerung richtete und neben der rationelleren Verwertung der Nahrungsmittel bei den Kochvorgängen Familien auch Einsparungsmöglichkeiten bei Brennmaterialien durch die Mitnahme der Mahlzeiten anbot.[14]

Wiener illustrierte Zeitung. 23.1.1915. S. 11.
In der Wiener Urania hielt sie zu dieser Zeit regelmäßig Vorträge zur Kriegskost, so wie u.a. zur „Bestellung des Kriegsmittagstisches“.[15] Regelmäßig erschienen von ihr Artikeln in der Zeitung „Die Zeit“ oder im Blatt der Hausfrau die redigierte Rubrik „das Reich der Hausfrau“, wo sie Rezepte für eine Kriegsküche lancierte.[16] Daraus entstand noch im selben Jahr ihr erstes Kriegskochbuch „Das Kriegskochbuch der Frauenzeitschrift „Wiener Mode“[PDF], das sich heute an der Wienbibliothek befindet. Daneben hielt sie „hauswirtschaftliche Sprechstunden“ im Rahmen der Kriegsfürsorge in Wien, die vom „Das Blatt der Hausfrau“ und „Wiener Modenwelt“ zur Unterstützung eingerichtet worden waren.[17] Im Herbst 1915 übernahm sie die wirtschaftliche Leitung der Baracken für verwundete Militärangehörige der Wiener Freiwilligen Rettungsgesellschaft, wofür sie vom Erzherzog Franz Salvator die Ehrenmedaille mit der Kriegsdekoration verliehen bekam,[18] und im Garnisonsspital Nr. 2 übernahm sie die Leitung der ersten Diätküche eines Militärspitals in Wien. Mit ihrem Vorgesetzten an der medizinischen Abteilung, dem Stabsarzt Dr. Walter Zweig (1872-1953),[19] beschäftigte sie sich mit der Ernährung der Erkrankten und Verwundeten in den Kriegsspitälern,[20] woraus sie gemeinsam ab 1917 ein Projekt zur Errichtung von „Krankenküchen“ entwickelten, in denen eine spezielle Krankenkost zubereitet wurde.[21] 1916 unterbreitete sie dem Kriegsministerium ihren Vorschlag Frauen zu Wirtschafterinnen und Leiterinnen von Spitalsküchen auszubilden,[22] dem das Ministerium mit der Umsetzung schon im Sommer 1916 mit einem zwei-monatigen Ausbildungskurs folgte und damit einen neuen Frauenberuf, jenen der Wirtschaftsbeamtinnen für k.k. Sanitätsanstalten schuf. In den ersten Kursen übernahm Marianne Stern die praktische Schulung während für den theoretischen Teil des Kurses der Stabsarzt Walter Zweig und Prof. Viktor Grafe (urspr. Löwy) (1878-1936) verantwortlich waren.[23] Im Februar 1917 wurde sie in der Leopoldstadt in Wien als Fachfrau für die Bildung von Kriegsküchen für Schulkinder herangezogen, wo sie auch in dem dazu gebildeten Komitee als Vizepräsidenten fungierte.[24] Noch während des Krieges 1918 erschien von ihr im Verlag ihres Vaters das zweite Kriegskochbuch unter dem Titel „Zeitgemäße Kriegsküche. Obst- und Gemüse-Rezepte. Mit einem Sachregister“ [PDF].

Oesterreichische Buchhändler-Correspondenz. 22.5.1918. S. 14.
Marianne Sterns Arbeit in der Zwischenkriegszeit: Buchautorin, und Antiquarin und Modernisierung der Wiener Gemeinschaftsküche der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreich (ROHÖ)
Im Juli 1919 erfolgte ihre Ernennung zur Inspektorin für die Spitalsküchen der Sanitätsanstalten für Heeresangehörige.[25] In dieser Funktion im Gesundheitsamt der Stadt Wien verfolgte sie 1920 gemeinsam mit Julius Tandler (1869-1936) die Idee in den Baracken des ehemaligen Kriegsspitals Grinzing ein Kinderspital für tuberkulosegefährdete Kinder zu errichten, aus dem das „Vienna Childrens Milk Relief“ hervorging.[26] 1921 koordinierte sie als Mitglied des Zentralrates geistiger Arbeiter und in dessen Aktionskomitee die Fürsorgestelle für erkrankte geistige Arbeiter.[27] Ab 1921 führte sie ihre seit 1916 geschlossene Kochschule am Getreidemarkt Nr. 17 wieder weiter.[28] 1925 eröffnete sie als dessen Leiterin die erste vegetarische Gemeinschaftsküche im Elisabethhof in Wien,[29] und ein Jahr später führte sie ebenfalls als Leiterin des Vereins Elisabeth-Heim eine neu errichtete Koch- und Haushaltsschule.[30]
Im Herbst 1921 wurde Stern zur Reorganisation der in Wien existierenden Gemeinschaftsküchen der ROHÖ bestellt, wo sie nach modernen ernährungswissenschaftlichen Grundlagen die Küche organisierte, sie mit einem Take-away-Service erweiterte, und den Betrieb eine Diabetikerküche anschloss. [31] Ende 1923 schuf sie in Hamburg nach einen Besuch der „Ausstellung der Hausfrau in Hamburg“ vom Bund hamburgischer Hausfrauen[32] eine „österreichische Gemeinschaftsküche“, die für 500 Personen eingerichtet worden war und sich vor allem an Mittellose und Arbeitslose richtete.[33] Mit dem Flugblatttitel der ROHÖ „Bildet Hausgemeinschaften!“[34] und einem Artikel im Neuen Wiener Journal propagierte sie die „Vereinfachung des Haushaltes durch gemeinsame Arbeit“ und rief zur Bildung von Gemeinschaftsküchen durch den Zusammenschluss mehrere Hausparteien zu Kochgemeinschaften auf.[35]
In den 1920er und 1930er Jahren war Marianne Stern vor allem als Buchautorin und Vortragende in der Öffentlichkeit präsent, darunter im Radio Wien in der Radiovolkshochschule „Stunde der Frau“ oder mit Lichtbildvorträgen in den Volkshochulen wie der Urania. Ebenso veröffentlichte sie regelmäßig in Zeitungen wie dem „Neuen Wiener Journal“ oder in den aufkommenden Lifestyle-Zeitschriften wie „Die Bühne“. Ab Mitte der 1920er Jahre kamen von ihr eine Reihe von Büchern heraus, die sowohl die unter den Folgen einer hohen Arbeitslosigkeit leidende Bevölkerung und die seit den Kriegstagen akute Frage der Säuglingsernährung berücksichtigte. Gleichzeitig gestaltete sie Bücher, die den zu dieser Zeit geweckten Begehren einer neuen ernährungswissenschaftlichen Küche und jener in den 1920er Jahren in Film, Werbung und Printmedien sich etablierenden Körperkultur folgten. Diese diversifizierten Ansprüche kamen in ihrem 1925 im Verlag ihrer Familie (Moriz Stern) erschienenen Buch „Die gute Wiener Küche. Eine Sammlung von 1000 erprobten Rezepten für die einfache und feine Küche bei sparsamstem Materialverbrauch. Unter besonderer Berücksichtigung der fleischlosen Kost, der diabetischen Küche und einem Anhang: Die Säuglingskost“, so wie dem 1929 veröffentlichten Kochbuch „Säuglingspflege und -ernährung (System Professor Pirquet). Mit einem Kinder-Tagebuch. Von Grete Müller“ zum Ausdruck. 1927 publizierte sie „Wiener Mehlspeisen und Vorspeisen. 500 erprobte Rezepte für den modernen Haushalt, mit einem Anhang: Herstellung von Bargetränken, Bowlen, Punsch und Likören“. 1929 erschien von ihr „Süsses und Pikantes für den Kaffee- und Teetisch mit besonderer Berücksichtigung sparsamen Materialverbrauches“ und „Weekend-und Touristen-Kochbuch“ und 1930 die Bücher „Koche gut – koche schnell! Eine Sammlung von erprobten, modernen Kochrezepten aus dem Kreise der Meinl-Kunden“, „Hundert leichte Erfrischungsspeisen aus Obst und Gemüse. Herstellung vitaminreicher Kost“ und das „Weekend- und Touristenkochbuch“. Ebenfalls in diesem Jahr kam ihr Buch „Küchentechnische Anleitung zur Herstellung der kochsalzfreien Diät nach Gerson und Herrmannsdorfer-Sauerbruch. Mit zahlreichen Rohkost-Rezepten“ auf dem Markt, das sich heute an der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien befindet.
Seit 1924 besaß Marianne Stern, die Filiale des Central-Antiquariates und Verlagsbuchhandlung ihres 1913 verstorbenen Vaters in Wien 1, Karl Lueger-Platz 3, das nach dessen Tod zunächst von seiner Ehefrau Charlotte weitergeführt und danach ihr überschrieben wurde.
NS-Verfolgung
Die Familie Stern war jüdischer Herkunft und der NS-Verfolgung ausgesetzt. Die Mutter von Marianne, Charlotte Stern, verstarb am 11. April 1939 in Wien, ihre Schwester Gisela, die den Hauptsitz des Central-Antiquariat und Verlagsbuchhandlung des verstorbenen Vaters Moriz Stern besaß, beging am 12. September 1939 Suizid. Die Buchhandlung von Marianne Stern wurde im Jänner 1939 mit Genehmigung der Vermögensverkehrsstelle von ihrem langjährigen Mitarbeiter der Firma „arisiert“.
Marianne Stern gelang im Februar 1940 die Flucht aus Wien nach Italien. Im April 1940 emigrierte sie mit der SS Saturnia von Triest nach New York. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.
Quellen:
Mentzel Walter: Stern, Moritz. Centralantiquariat und Verlagsbuchhandlung Wien, in: Lexikon der österreichischen Provenienzforschung.
Archiv der IKG Wien, Geburtsbuch 1882, Stern Marianne.
OeStA/AdR, E-uReang, FLD, 8958, Stern Marianne.
OeStA/AdR, E-uReang, VVSt, Handel 2388, Stern Marianne.
OeStA/AdR, E-uReang, VVSt, VA 3446, Stern Marianne.
WStLA, M.Abt. 119, A41, 443, Bezirk: 1, Stern Marianne.
WStLA, M.Abt. 119, A41, C 119, Bezirk: 10, Stern Marianne.
New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925–1957, Stern Marianne.
Literaturliste:
Stern, Marianne: Küchentechnische Anleitung zur Herstellung der kochsalzfreien Diät nach Gerson und Hermannsdorfer-Sauerbruch. Mit zahlreichen Rohkost-Rezepten. Leipzig und Wien: Franz Deuticke 1930.
[Universitätsbibliothek Medizinische Universität Wien/Sign.: 2018-01994]
Keywords:
Ernährungswissenschaften, Erster Weltkrieg, Marianne Stern, NS-Verfolgung, Sanitätswesen, Spitalsküche
[1] Wiener medizinischen Wochenschrift. Nr. 39. 1931.
[2] Wiener Hausfrauen-Zeitung. Nr. 16. 1906. S. 243.
[3] Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine. H. 4. 1908. S. 15.
[4] Neue Freie Presse. 8.10.1908. S. 14.
[5] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 1.2.1909. S. 9.
[6] Österreichische Buchhändler-Correspondenz. 15.1.1908. S. 4.
[7] Miteilungen des Frauenvereins „Diskutierklub“. H. 3. 1908. S 1-3.
[8] Die Zeit. 1.5.1908. S. 7.
[9] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 10.3.1910. S. 12.
[10] Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine. H. 6. 1910. S. 12.
[11] Neue Freie Presse. 28.9.1910. S. 11.
[12] Wiener Hausfrauen-Zeitung. Nr. 1. 1908. S. 12; Reichspost. 19.3.1912. S. 6.
[13] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 6.5.1910. S. 8.
[14] Der Morgen. Wiener Montagsblatt. 19.10.1914. S. 8.
[15] Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine. H. 3. 1915. S. 16; Neue Freie Presse (Abendblatt). 3.3.1915. S. 1.
[16] Blatt der Hausfrau. H. 8. 1915-16. S. 13.
[17] Arbeiter Zeitung. 24.10.1915. S. 9.
[18] Die Zeit. 14.11.1915. S. 8.
[19] Neue Freie Presse. 18.6.1915. S. 12.
[20] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 3.1.1917. S. 9.
[21] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 24.1.1917. S. 9.
[22] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 18.6.1918. S. 13.
[23] Der Morgen. Wiener Montagblatt. 24.7.1916. S. 14.
[24] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 6.2.1917. S. 10-11.
[25] Neues Wiener Journal. 17.7.1919. S. 7.
[26] Neues Wiener Journal. 7.12.1920. S. 3.
[27] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 13.3.1921, S. 7.
[28] Neue Freie Presse. 30.8.1921. S. 20.
[29] Der Tag. 8.2.1925. S. 2.
[30] Die Stunde. 18.9.1926. S. 4.
[31] Neues Wiener Journal. 28.10.1921. S. 4.
[32] Neues Wiener Journal. 7.7.19213. S. 4.
[33] Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 1.1.1924. S. 14.
[34] Roho-Frauen-Flugblatt. H. 5, 1923. S. 2.
[35] Neues Wiener Journal. 4.10.1922. S. 4.
Normdaten (Person) Stern, Marianne : BBL: 39236; GND: 1026758270;
Bio-bibliografisches Lexikon (BBL)/Liste aller Beiträge der VS-Blog-Serie: Aus den medizinhistorischen Beständen der Ub MedUni Wien
Bitte zitieren als VAN SWIETEN BLOG der Universitätsbibliothek der Medizinischen Universität Wien, BBL: 39236 (20.06.2022); Letzte Aktualisierung: 2022 06 20
Online unter der URL: https://ub-blog.meduniwien.ac.at/blog/?p=39236